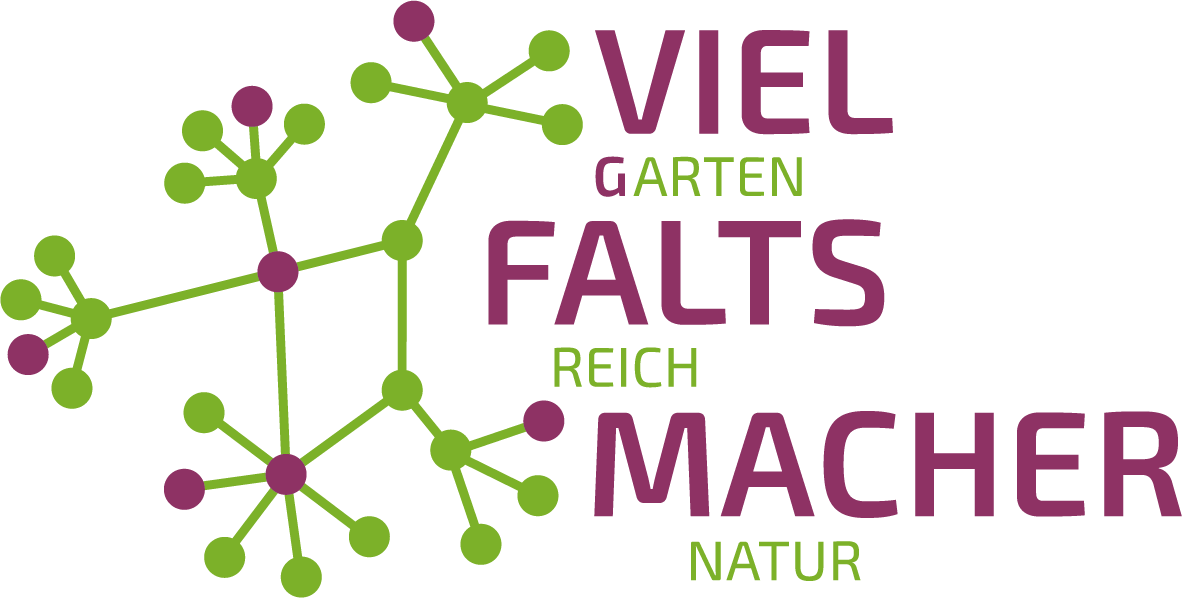Natur und Landschaft
Gärtnern ohne Torf

Lebensraum- und Klimaschutz
Intakte Moore sind die effektivsten und größten Kohlenstoffspeicher auf der Erde. Obwohl sie nur 3 % der Erdoberfläche bedecken, binden sie in ihren Torfschichten ein Drittel des terrestrischen Kohlenstoffs und mehr als alle Wälder dieser Erde zusammen. Zudem haben sie eine enorme Wasserspeicherkapazität, was natürlich sehr zum regionalen Hochwasserschutz beiträgt.
Kohlendioxid wird freigesetzt
Bei der Entwässerung der Moore, die vor dem Torfabbau notwendig ist, wird aus dem ehemaligen Kohlenstoffspeicher ein Kohlenstoff freisetzendes System. Sobald der Torf bei der Entwässerung in Kontakt mit Sauerstoff kommt, tritt ein Abbauprozess ein, bei dem der Torf mineralisiert wird. In der Folge entweichen nicht nur riesige Mengen Methan (CH4) und Kohlendioxid (CO2), sondern zusätzlich auch Lachgas (N2O), dessen klimaschädliche Wirkung 300-mal höher ist als die des CO2. Entwässerte Moore werden so zur Treibhausgasquelle und tragen erheblich um Klimawandel bei.
Außerdem werden mit der Trockenlegung von Mooren wertvolle und sensible Ökosysteme zerstört. Auch wenn eine anschließende Renaturierung stattfindet, kann der Urzustand nur bedingt und nur sehr langfristig wiederhergestellt werden – falls die Renaturierung überhaupt gelingt. Damit sich eine 1 m hohe Torfschicht, die in kürzester Zeit abgebaut wurde, neu bildet, dauert es 1.000 Jahre.
Torfabbau weltweit
Moore werden auch heute noch in großem Umfang entwässert und Torf abgebaut, weltweit ca. 40 Mio. m³, davon 83 % in Europa, v.a. in Weißrussland, Baltikum, Skandinavien und Irland. Hauptabnehmer für die aus dem Torf gewonnenen Blumenerden sind Deutschland und die Niederlande. Aber auch in Deutschland selbst werden noch jedes Jahr 6 bis 8 Mio m3 Torf, insbesondere in Niedersachsen, auf 6.000 ha abgebaut. Der Torf wird zu ca. 11 Mio m³ Substraten verarbeitet, von denen etwa 3,5 Mio. m³ als Erden in den Freizeitgartenbau gehen.
Ende in Sicht?
Im Klimaschutzprogramm 2030 hat sich die Bundesregierung verpflichtet darauf hinzuwirken, dass im Freizeitgartenbau auf den Einsatz von Torf in den kommenden Jahren verzichtet wird. Angestrebt wird der vollständige Verzicht bis 2026.
Im Erwerbsgartenbau soll bis zum Ende des Jahrzehnts ein weitgehender Ersatz von Torf stattfinden. Bereits jetzt gibt es torffreie Erden oder torfreduzierte Erden. Je nach dem Verwendungszweck geht der Ausstieg bei bestimmten Kulturen schneller, bei anderen wird es länger dauern. Weihnachtssterne oder Stauden werden jetzt schon torffrei produziert und die Entwicklung schreitet kontinuierlich voran. Aktuell liegt der Torfersatz in Deutschland bei 30 %. Oberstes Prinzip für die Erdenhersteller und Erwerbsbetriebe ist die Kultursicherheit bei den verwendeten Ersatzstoffen und deren langfristige und ausreichende Verfügbarkeit. Die Pflanzen müssen auch in torffreien bzw. torfreduzierten Substraten genauso gut und sicher wachsen wie bisher.
Problematisch bei den Ersatzstoffen ist die Situation erstaunlicherweise bei Kompost. Qualitativ hochwertige Komposte sind eine Herausforderung (Reste aus der Biotonne sind nicht geeignet) und stehen nicht immer ausreichend zur Verfügung. Ebenso schwierig ist die Situation bei den kokosbasierten Rohstoffen, ganz gut schaut es dagegen aus bei Substratholzfasern. Schwer einzuschätzen sind die weltweiten Lieferketten, insbesondere für Kokosfasern, die v. a. aus Indien, Sri Lanka und der Dominikanischen Republik kommen. Solange alles gut läuft sind Lieferungen unproblematisch, aber da gab es auch schon manch böse Überraschung. Alternativen zum Torf sind Mischungen mit Kompost, Holzfasern, Ton, Perlite und Kokos oder auch rein mineralische Substrate auf Basis vulkanischer Rohstoffe wie Bims, Lava und Zeolith aus der Eifel. Auch mit völlig neuen Stoffen wird experimentiert, z.B. der Substratfaser Nygaia, die über hervorragende gartenbauliche Eigenschaften, v.a. in der Jungpflanzenanzucht verfügt.
Gärtnern mit Torf
Torf wurde im Grunde erst vor ca. 60 Jahren im Gartenbau verwendet. Sehr schnell galt er als angeblicher Wunderstoff für Pflanzen und wurde großzügig eingesetzt, aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften für den Erwerbsgartenbau:
- günstige physikalische Eigenschaften
- hohe Wasserspeicherfähigkeit bei ausreichend hohem Luftgehalt
- hohe Strukturstabilität, damit bestens geeignet für die Kultur in kleineren Töpfen oder Kübeln
- hinsichtlich pH-Wert und Nährstoffgehalt sehr gut steuerbar
- in der Regel frei von Krankheitserregern und Unkrautsamen.
Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass es kein einzelnes Material gibt, das Torf in den derzeitigen Anwendungsbereichen allein ersetzen kann. Es konnte jedoch eindeutig nachgewiesen werden, dass durch die zielgerichtete Kombination hochwertiger Ersatzstoffe torfreduzierte und torffreie Blumenerden hergestellt werden können, die auch hohen Ansprüchen genügen.
Gärtnern ohne Torf
Dies ist im Grunde keine neue Erfindung sondern wurde seit Generationen praktiziert. Jede Gärtnerei hat sich seine Erden selbst gemischt und auch alle Freizeitgärtner hatten so ihre eigenen Rezepte. Basis war der eigene Kompost (aber gut verrottet muss er sein und mehrmals umgesetzt). Zu beachten sind die höheren Nährstoff- und Salzgehalte und der höhere pH-Wert. Reiner Kompost ist in Töpfen nicht strukturstabil und verdichtet. Daher sind Mischungen mit anderen Materialien wie Rindenhumus, Holzfasern, Kokosprodukten, Gartenerde (auch Erde von Maulwurfshügeln), Sand und mineralischen Zuschlagstoffen wie Gesteinsmehle, Blähton, Perlite etc. sinnvoll. Solche Erden liefern ein gutes Substrat, in dem Sommerblumen, Balkonpflanzen und Gemüsepflanzen in Pflanzgefäßen gut gedeihen. Für mehrjährige Kübelpflanzen sollte zusätzlich ein ausreichender Anteil eines mineralischen Zuschlagstoffes wie Blähton, Ziegelsplitt, Basalt-/Bimsgrus beigemischt werden.
Es war eine altbewährte und nachhaltige gärtnerische Praxis, eine sinnvolle Kreislaufwirtschaft. Nur mit Torf wurde vieles halt bequemer.
Torffreie Substrate funktionieren
Untersuchungen aus Weihenstephan zeigen, dass sich torffreie Substrate (u.a. mit Xylit, Grüngutkompost, Rindenhumus, Holzfaser, Kokosfaser) auch bei ungünstigen Bedingungen bewähren und zum Beispiel sehr ansehnliche Balkonkästen kultiviert werden können. Zu beachten ist allerdings, dass im Gegensatz zu Weißtorf die Eigenschaften der meisten Torfersatzstoffe hinsichtlich Nährstoffgehalt sehr stark schwanken können. Torffreie Erden sind meistens etwas gröber, lockerer und schwerer als torfhaltige Substrate.
Die wechselnde, nicht standardisierbare Zusammensetzung und die nicht immer optimalen Eigenschaften hinsichtlich pHWert, Salzgehalt, Wasserhaltevermögen oder Nährstoffverfügbarkeit machen die Kulturführung mit torffreien Substraten etwas anspruchsvoller. Oftmals ist die Wasserhaltefähigkeit von torfreduzierten bzw. torffreien Substraten geringer, als man dies von Torf gewohnt ist. Daher kann es notwendig sein, statt ein- auch zweimal täglich zu gießen. Auf möglicherweise auftretende
Nährstoffmangelsymptome, insbesondere bei Stickstoff, muss mehr geachtet und mit einer Nachdüngung reagiert werden. Stickstoffmangel zeigt sich dadurch, dass die Wüchsigkeit merklich nachlässt und sich die Blätter hellgrün bis gelblich verfärben. Dies tritt zunächst bei den älteren Blättern auf.
Kein Torf zur Bodenverbesserung
Lange Zeit wurde Torf gerne als Mittel zur Bodenverbesserung oder zur Beigabe ins Pflanzloch verwendet. Diese Maßnahme ist absolut unnötig, pure Ressourcenverschwendung und schon längst überholt. Viel sinnvoller und umweltfreundlicher ist es, die Bodeneigenschaften durch die Einarbeitung von Ernterückständen, Gründüngungspflanzen oder Kompost zu verbessern. Die angeblich lockernde Wirkung von Torf ist nur von sehr kurzer Dauer.
Gärtnern ohne Torf ist eines der Hauptkriterien bei der Naturgartenzertifizierung und Torf ist im Freizeitgartenbereich definitiv überflüssig. Jeder Sack torfhaltiger Blumenerde, den wir nicht verwenden, ist ein wirksamer Beitrag zum Erhalt der Moore und somit zum Natur- und Klimaschutz, denn 95 % der Moorflächen Deutschlands gelten als zerstört. Eine verheerende Bilanz sowohl für die spezialisierten Arten, die auf diesen Lebensraum angewiesen sind, als auch für die Senkung klimaschädlicher Emissionen. Die Zerstörung der Moore muss enden, ihre Entwässerung, Abtorfung und landwirtschaftliche Nutzung gestoppt werden, eine Renaturierung erfolgen.
Bitte nur noch »torffrei«
Das Angebot bei den Erden ist manchmal etwas verwirrend. Von »Bio« bis »Nachhaltig« ist alles dabei. Aber nur wenn explizit »torffrei« draufsteht ist die Erde auch wirklich ohne Torf hergestellt. Auch wenn diese Erden meistens ein paar Euro teurer sind, sollte es uns dies wert sein, unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Denn trotz aller Bemühungen und Absichtserklärungen steuern wir nach wie vor auf eine Klimakatastrophe zu. Der Gehalt an CO2 und insbesondere Methan in der Atmosphäre steigt weiter an. Die 1,5 °C-Marke, die man eigentlich erst im Jahr 2040 erreichen wollte, ist bereits Realität. Selbst die größten Pessimisten unter den Klimaforschern hätten nicht erwartet, dass es so schnell geht.
Dr. Hans Bauer